
Regie: Jim Jarmusch / USA, Schweden 2019 / 105 Min.
Darsteller: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Carol Kane, Selena Gomez, Tom Waits
Freigabe: FSK 16
Verleih: Universal
Start: 13.06.2019
Der Tag der toten Lebenden. Von heute auf morgen ereignet sich in der friedlichen Kleinstadt Centerville ein absonderliches Naturphänomen: Es wird nicht mehr dunkel. Die Medien berichten, dass daran Fracking-Bohrungen am Nordpol schuld seien, durch welche sich die Erdachse verschoben habe, aber für die amerikanische Regierung ist dieses Weltuntergangsszenario bisher kein Grund, um in Panik zu geraten. Erst mal die Ruhe bewahren, zu Hause bleiben, die Türen verschließen.
Auch den Sheriff Cliff Robertson (Bill Murray) und seinen Hilfssheriff Ronnie Peterson (Adam Driver) bringen die Ereignisse in ihrer provinziellen Monotonie nur sehr gemächlich aus der Streifenwagen-Routine. Dafür ist in dieser Gegend, in der kaum eine lebende Seele zu sehen ist, zu wenig los. Der Landstreicher Hermit Bob (Tom Waits) soll dem rassistischen, “Make America great again”-Cap-tragenden Farmer Miller (Steve Buscemi) ein Huhn gestohlen haben, streitet den Vorwurf allerdings ab. Als sich dann jedoch einige Verstorbene aus ihren Gräbern emporbuddeln, die Bewohner fleischhungrig anbeißen und diese auch in Zombies verwandeln, müssen die lethargisch wirkenden Ordnungshüter mit ihrer uniformierten Kollegin Mindy Morrison (Chloë Sevigny) und der Samuraischwert-tragenden schottischen Bestatterin Zelda Winston (Tilda Swinton) gezwungenermaßen den Kampf aufnehmen und – wie man das in Zombiefilmen eben so macht – Köpfe rollen lassen.
Jarmusch bleibt Jarmusch
Das Schöne an einem Jim-Jarmusch-Film ist, dass er von Jim Jarmusch ist. Seit seinem wegweisenden Debüt PERMANENT VACATION (1980) hat er über außergewöhnliche Werke wie NIGHT ON EARTH (1991) bis COFFEE AND CIGARETTES (2003) hinweg wie nur wenige unabhängige Regisseure seinen eigenen Stil weiterentwickelt und zugleich die Filmgeschichte ästhetisch mitgeprägt.
Wer Jarmusch-Filme kennt, der weiß, wie sie funktionieren und auf was man hoffen darf. Auch in BROKEN FLOWERS (2005), LIMITS OF CONTROL (2009) und PATERSON (2016) wurde man mit dieser Erwartungshaltung nicht enttäuscht. Seine originelle Erzählweise ist reduziert, langsam, lakonisch, wie seine Figuren, die auf ihre eigene Weise merkwürdig, exzentrisch, grotesk sind. Weil in seinen filmischen Wirklichkeiten immer schon alle Erdachsen verschoben sind, haben sie stets auch eine komische Seite, sind nicht direkt Komödien, aber auch nicht ganz unlustig. Unter seinen Protagonisten gab es immer schon solche, die leblos und ziellos durch die Gegend wanderten oder mit einem Fuß im Grab standen, als halb tote Männer, Geister oder Vampire – siehe DEAD MAN (1995), GHOST DOG (1999) und ONLY LOVERS LEFT ALIVE (2013). Jarmusch macht Roadmovies, Autofilme, Dialogfilme, die außerhalb und zwischen den Genres cruisen, die zumeist etwas Mysteriöses, Unerklärbares verströmen, in deren Bedächtigkeit man nicht nur zuschauen, sondern vor allem zuhören und mitdenken kann. Seine Helden wirken grundsätzlich verloren, fallen eher durch lange, skurrile Konversationen auf und weniger durch dynamische Aktionen und überstürzte Handlungen.
Dabei hat seine Inszenierungsweise postmoderne Moden überstanden und sein Stammensemble mit Stars wie Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop und Tom Waits auch Ausflüge in verschiedenartige Gattungen überlebt. Immer wieder hat der Autorenfilmer gezeigt, wie man jenseits von Hollywood mit so unterschiedlichen Schauspielerinnen und Leinwandkörpern von Roberto Benigni bis Selena Gomez unkonventionelle Welten und Bilder erschaffen kann.
Wenn man bei Éric Rohmers Filmen den Eindruck haben kann, “als würde man Farbe beim Trocknen zusehen” – wie Gene Hackman einmal in einer Filmrolle behaupten durfte –, so hört man in Jarmusch-Filmen der Musik mit ihren knarrenden Gitarren-Delays und langen Hallfahnen beim Verklingen zu. Auf gewisse Weise ist dieser Film auch ein eigenwilliges Musikvideo für den gleichnamigen Titelsong “The Dead Don’t Die”, der über den Film hinweg mehrmals zu hören ist, der ausgiebig von den Figuren gelobt wird und dessen Komponist, der Countrysänger Sturgill Simpson, selbst als Zombie mit Gitarre auftaucht.
Die Postmoderne frisst ihre Regisseure
Wenn man das Jarmusch-Œuvre schätzt, dann fällt es nicht leicht, über THE DEAD DON’T DIE zu urteilen. Es ist einer dieser Filme, die nicht wirklich enttäuschen, nicht unbedingt scheitern, aber einen doch unbestreitbar ernüchtert und emotionslos aus dem Kino entlassen. Der Film selbst ist untot, leblos, geistert so umher und nimmt, wie Deputy Ronnie Peterson beständig betont, kein gutes Ende. Das, was man an guten postmodernen Filmen so schätzt, wie ein spielerischer Umgang mit Genreelementen, mit Klischees und Stereotypen, die in parodistischer Form zitiert, bestätigt und aufgebrochen werden, verwandelt sich hier in eine zu lustlose postpostmoderne Leichenfledderei. Man möchte gar nicht erst auf das Offensichtliche eingehen, auf die Romero-Referenzen und all die anderen oberflächlichen Verweise, man möchte nicht weiter über die platte gesellschaftspolitische Botschaft nachdenken, für welche die Konsum-, Musik-, Smartphone-, Fashion- und Filmzombies herhalten sollen, denn man merkt schnell, dass man als Genrefan dabei sogleich in genau ebendiese Zombiefalle dieses Films tappen würde, der einem ja plakativ vor Augen führt, dass man sich – angeblich wie ein willenloser Untoter – immer nach den Dingen sehnt, die man schon immer konsumiert hat, die man immer schon mochte und schätzte.
THE DEAD DON’T DIE ist keineswegs eine Zombiekomödie, sondern vielmehr die Parodie einer Parodie. Und daher wirken auch die selbstbezüglichen Stellen geradezu etwas verbittert, dann, wenn beispielsweise die Figuren feststellen, dass sie im Radio den Titelsong dieses Films hören oder dass ihnen Jim unterschiedliche Versionen des Drehbuchs gegeben hat. Es mutet so an, als wolle Jarmusch vermitteln: Wenn ich wollte, dann könnte ich auch einen Zombiefilm drehen – aber wozu sollte ich das tun? So fühlt sich das letztlich an – beziehungsweise eben nicht.
(Martin Martin Schlesinger)
Lebloses Genremassaker
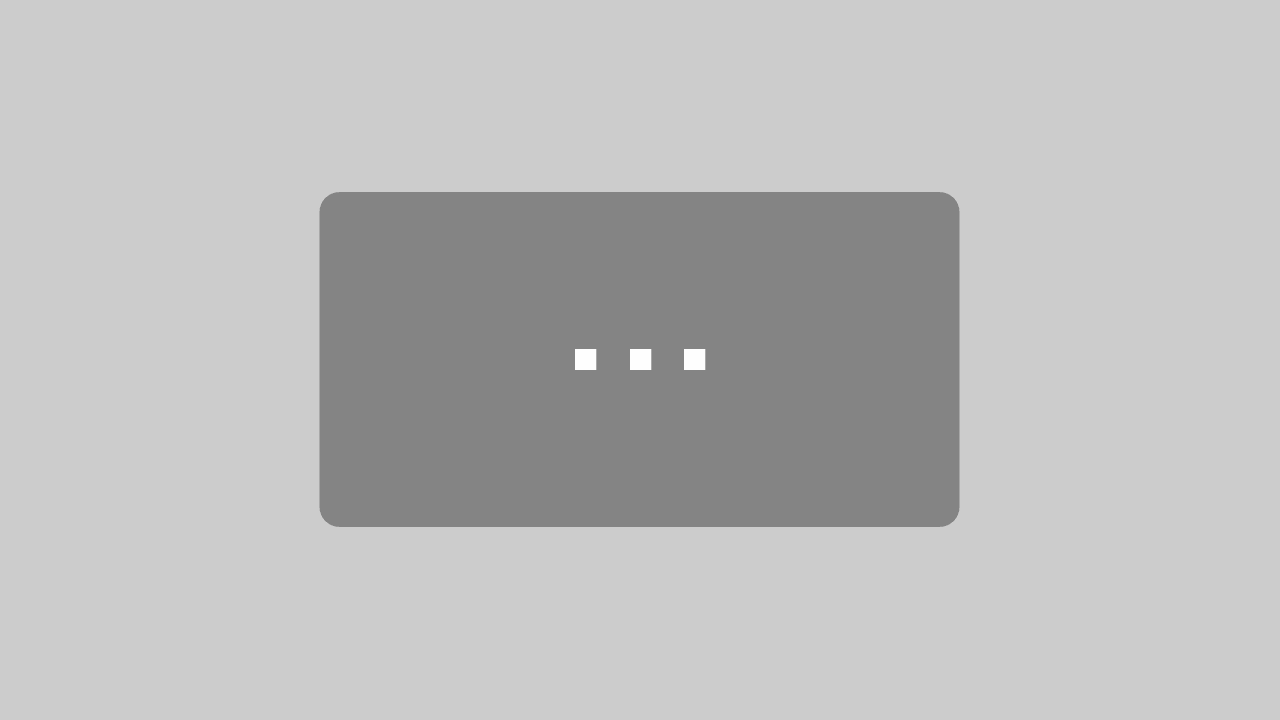
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Regie: Jim Jarmusch / USA, Schweden 2019 / 105 Min.
Darsteller: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Carol Kane, Selena Gomez, Tom Waits
Freigabe: FSK 16
Verleih: Universal
Start: 13.06.2019
